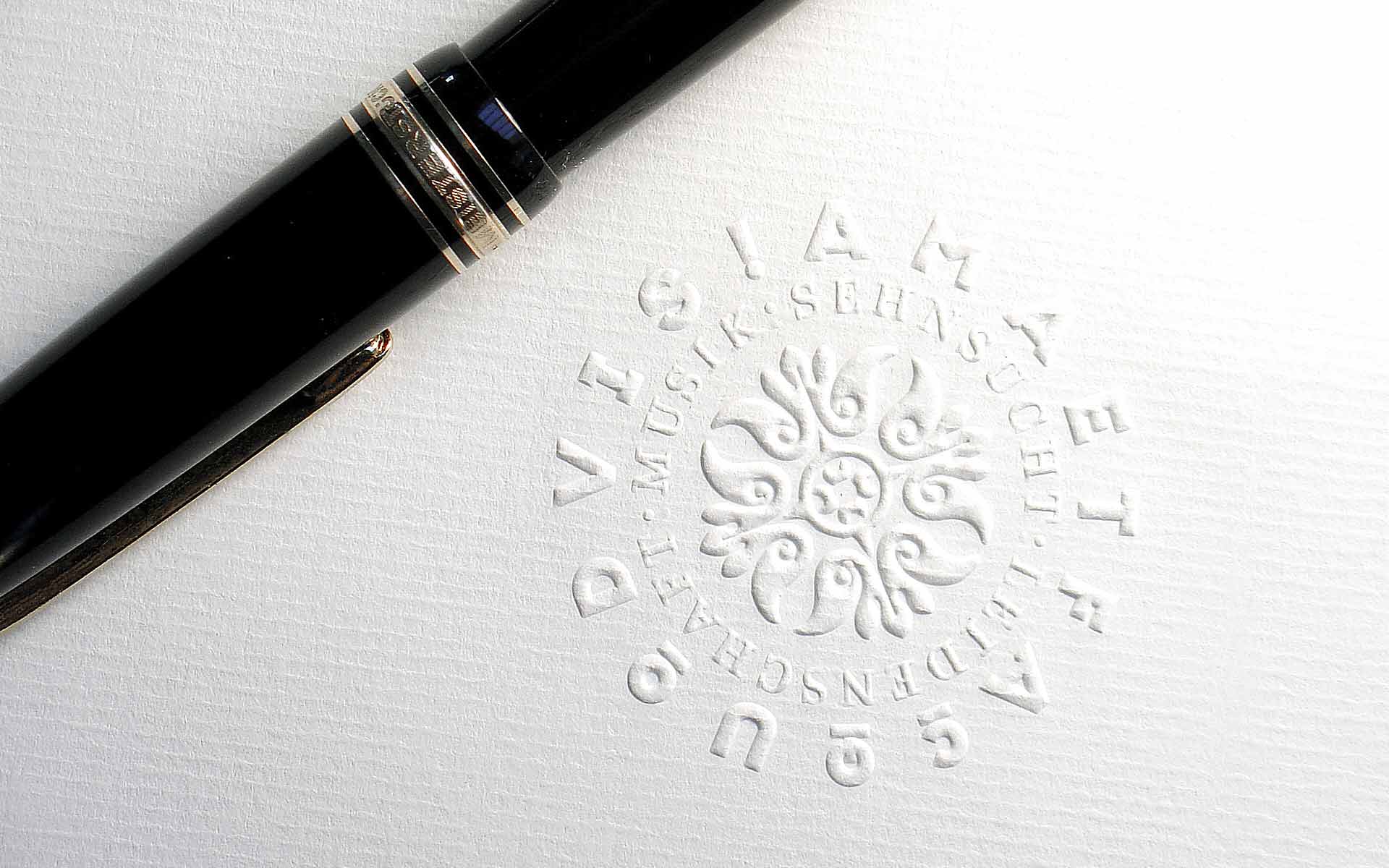Das Credo »Ama et fac quod vis! Sehnsucht : Leidenschaft : Musik«.
Projekt
Konzeption eines Credos (Sinnspruchs) sowie grafischer Entwurf eines Präge-Signets, einer Briefpapierausstattung und einer Website für einen Dirigenten
Designleistungen
Grafikdesign, Claim-Entwicklung, Webdesign und Fotografie
Gestaltete Medien
Briefpapiere und Website
Medienproduktion
Fotoshooting, Bildbearbeitung, HTML-Entwicklung (Website der 3. Generation, HTML 4.01) inkl. Suchmaschinenoptimierung (SEO), DTP – Desktop Publishing (Satzherstellung), Printproduktion und Druckveredelung
Branche
Kultur- und Kreativwirtschaft
Auftraggeber
Peter Stangel, Dirigent, München, Germany
Jahr
2003
Project
Development of a credo (motto) and graphic design of an embossed emblem, a stationery set, and a website for a conductor
Design Services
Graphic design, tagline development, web design, and photography
Designed Media
Stationery and website
Media Production
Photo shoot, image editing, HTML development (3rd-generation website, HTML 4.01) including search engine optimization (SEO), DTP – desktop publishing (typesetting), print production, and print finishing
Industry
Cultural and creative industries
Client
Peter Stangel, conductor, Munich
Year
2003
Verwendete Hausschriften: Typeface Six von Neville Brody, UK, 1990, und Filosofia von Zuzana Licko, USA, 1996. Die Website entstand in HTML 4.01 (W3C-Standard von 1999). Responsive Webdesign war damals noch unbekannt. Sie wurde als »Liquid Layout« konzipiert und lief auch auf dem ersten iPhone (2007) problemlos.
Hintergrundinformation
Die Ausgangssituation
Der Dirigent Peter Stangel bat Wolfgang Beinert, ihm ein ungewöhnliches Signet zu entwerfen. Das Design sollte keinesfalls eine kommerzielle oder gar werbliche Anmutung haben und sollte kulturell seiner Persönlichkeit entsprechen. Peter Stangel korrespondiert weltweit in fünf Sprachen und in unterschiedlichen Kulturräumen.
Kurz zum Auftraggeber
Peter Stangel ist Dirigent, Generalmusikdirektor und leidenschaftlicher Interpret u.a. von Mozart, Verdi, Wagner und Kurt Weill. Er sucht grundsätzlich die Balance zwischen Tradition und Moderne. »Ohne das angestammte Publikum zu verprellen, versuche ich neue Zuhörer heranzuziehen, zu gewinnen und Konzerte für neue Zuhörerkreise zu öffnen«, so Peter Stangel.
Analyse
Beinert beschäftigte sich mit Stangels Persönlichkeit, seinen zentralen Anliegen und Aussagen: Musik ist sein Leben. Dirigent ist für ihn kein Beruf, sondern Leidenschaft. Er sehnt sich förmlich danach zu dirigieren und Musik zu (er)leben. Er liebt Musik. Er ist einerseits tolerant und andererseits sehr klar. Er stellt Dinge in Frage. Er sucht den Kontakt. Er ist konservativ und zugleich modernen Dingen aufgeschlossen. Er ist Individualist. Er ist für bequeme Lösungen nicht zu haben.
Lösungsansatz
Nachdem Wolfgang Beinert sich intensiv mit Peter Stangel auseinandersetzte und ihn so näher kennenlernte, war für ihn klar, dass der Person Stangel ein formales Design nicht gerecht werden kann. Die Quintessenz seiner Überlegungen: Nur ein begrifflich fassbares Credo konnte der zentrale Ausgangspunkt einer Visualisierung sein.
Das Credo
»Ama et fac quod vis! Sehnsucht : Leidenschaft : Musik«. Das Credo (lat. credo … ich glaube für Auffassung, Bekenntnis) nimmt nicht nur auf Stangels Lebenskultur, sondern auch auf die Welt der großen Musik Bezug. Mozart, Verdi, Wagner, Weill. »Die Musik spricht nicht die Leidenschaft, die Liebe, die Sehnsucht dieses oder jenes Individuums in dieser oder jener Lage aus, sondern die Leidenschaft, die Liebe, die Sehnsucht selbst«. Richard Wagner formulierte diesen Satz 1876 bei der Eröffnung des Festspielhauses in Bayreuth. Übrigens der ersten Aufführung in der Musikgeschichte, bei der ein Dirigent vor dem Orchester stand und dem Publikum den Rücken zukehrte.
Kontrastiert wird dieser schon beinahe »wagnerianische« Claim durch das augustinische Credo »Liebe und tue was du willst!«. Wobei sich dadurch eine philosophische Spannung ergibt, die sich lange und individuell diskutieren lässt und den Betrachter somit förmlich zu einem Kontakt im Sinne des Bivalenzprinzips einlädt.
Typografie und Gestaltung
Die Typografie im Außenkreis: Typeface six von Neville Brody, England 1990, aus der Fontshop-Schriftenbibliothek. Sehr kräftige Zierschrift mit ungewöhnlichen, schon fast abstrakten Buchstabenkombinationen und -formen (C, Q und O). Eine Schrift, die die »Neue Zeit«, die Moderne verkörpert.
Innenkreis: Kapitälchen der Filosofia aus der Emigre-Schriftenbibliothek. Eine Antiquaschrift entworfen von Zuzana Licko, USA 1996. Diese Schriftgarnitur ist eine Modifikation der klassizistischen Bodoni von der Bauerschen Gießerei (1926). Sie hat allerdings einen deutlicheren Wechselschwung der Figuren. Der Duktus der Ziffern erinnert an Musiknoten des 19. Jahrhunderts, der großen Zeit des Dirigenten, des »primus interpares«. Die Filosofia verfügt über alle notwendigen Schnitte (Normal, Kursiv, Caps, Fett) und angelsächsische Ligaturen. Die gesamte Briefpapierausstattung ist in der Filosofia typographiert.
Zentrum: (Semi-)Heraldische Rose. Beinert bedient sich hier nicht der klassischen Heraldik, da diese Formensprache zu wenig Anmutung besitzt. Er illustriert die Rose im phantasiereichen französischen Stil des 19. Jahrhunderts.
Komposition: Die avantgardistisch wirkende Schrift im Außenkreis »schützt« die konservativen, zerbrechlichen Formen im Inneren des Signets. Die massive Typeface six ist sowohl als inhaltlicher als auch formaler Kontrast gedacht.
Produktion
Das Credo bzw. Signet wird grundsätzlich nur als Blindprägung implementiert. Niemals im Druck. Selbst auf den Briefhüllen und auf Etiketten ist das Credo geprägt. Das Signet darf erst auf den zweiten oder gar dritten Blick wirken.
Verständlichkeit
Das Credo verschmilzt in einer schlichten Text-Bild-Sprache zu einem Signet, das ohne Farbe auskommt. Der Claim im Außenkreis wurde bewusst in lateinischer Sprache formuliert, der Sprache der Humanisten und in der sehr modischen, internationalen Typeface six typographiert. Ein einfaches Lesen und Begreifen der Aussagen ist nur schwer möglich. Denn das Credo erschließt sich weder formal noch inhaltlich auf den ersten Blick.
Es wirkt dadurch mystisch, zeitlos und ist nicht sofort einzuordnen. Es trotzt dem Schnell-Schnell-Zeitgeist. Das Signet leistet sich einen elitären Luxus: Es ist erklärungsbedürftig. Es fordert den Betrachter und lädt ihn zu einer ernsthaften Auseinandersetzung und gerne auch zu einem niveauvollen Kontakt ein.
Grafikdesign zeigt sich hier pur, es ordnet sich unter und wird auf kluge und ästhetische Weise Mittel zum Zweck
Die Rose im Zentrum des Signets
Die Rose, in der Formensprache der Heraldik, ist Bestandteil des Credos. Die Rose, wegen ihres Duftes, ihrer Schönheit und Anmut, trotz der Dornen, eine der am häufigsten begegnenden Symbol-Pflanzen seit der klassischen Antike. Im Abendland spielt sie eine ähnliche bedeutende Rolle wie der Lotos in Asien. In der Antike war die Rose der Aphrodite (Venus) geweiht. Die rote Rose soll aus dem Blut des Adonis entstanden sein. Sie war ein Symbol der Liebe und der Zuneigung, der Fruchtbarkeit und auch der Verehrung gegenüber den Toten. Im Christentum war die rote Rose u.a. ein Signet für das vergossene Blut und die Wunden Christi. Sie symbolisiert außerdem die Schale, die das heilige Blut auffing. Sie ist deshalb auch das Zeichen der mystischen Wiedergeburt Jesus. In der Alchimie spielte die meist siebenblättrige Rose eine Rolle als Sinnbild komplexer Zusammenhänge, sei es z.B. der sieben Planeten mit den entsprechenden Metallen, sei es verschiedener Schritte innerhalb alchimistischer Operationen. Für die breite Bevölkerung ist die Rose – heute wie damals – das Symbol der Liebe.
Kurz zu Aurelius Augustinus (354–430 N.CHR.)
Der Philosoph und Theologe Augustinus wurde in Karthago in Rhetorik ausgebildet und im Jahr 374 Lehrer in diesem Fach. 383 wurde er nach Rom berufen und kurz danach in die Residenzstadt Mailand, wo er als Rhetor wirkte. Die Krisen seiner Jugend hat Augustinus um 397–401 in seinen Bekenntnissen niedergeschrieben. Die Bekenntnisse sind eine der ersten individualistischen Selbstbiographien der Weltliteratur.
Die Lektüre von Ciceros Hortensius führte Augustinus zur Philosophie. Viele Jahre war er Anhänger des Manichäismus, dann kurz der Skepsis. In Mailand lernte er den Neoplatonismus kennen und kam durch ihn zum Christentum. 387 ließ er sich taufen. Er wurde 391 zum Priester in Hippo Regius in Nordafrika ernannt. Von 396 bis zu seinem Tod war er in dieser Stadt Bischof.
Für Augustinus lassen sich Theologie und Philosophie nicht scharf unterscheiden. Diese Position zeigt sich u. a. in seiner Maxime: »Ich glaube, damit ich erkennen kann« (lat. credo, ut intelligam). Ohne die göttliche Erleuchtung in unserem Glauben können wir die Weisheit (lat. sapientia), mit deren Hilfe wir zur Glückseligkeit (lat. beatitudo) gelangen, nicht erkennen. Der Wunsch nach Glückseligkeit ist der einzige Grund zum Philosophieren. Die Philosophie ist ein Mittel, den Glauben zu vertiefen.
Augustinus knüpft an Platons Unterscheidung zwischen der veränderlichen Erscheinungswelt und der ewigen, unveränderlichen Ideenwelt der Vernunft an. Er greift Platons Gedanken, dass nur das Wirkliche voll und ganz erkannt werden kann, und dessen Dualismus zwischen Seele und Leib auf.
Gegen die Skeptiker wendet Augustinus ein: Wenn sich jemand in seinem Glauben irrt, existiert er, denn derjenige, der nicht existiert, kann auch nicht irren. Daraus folgt, wenn ich mich im Glauben an meine Existenz irre, existiere ich. Wenn ich existiere, so kann ich mich nicht in meinem Glauben an meine Existenz irren. Aus den beiden letzten Behauptungen folgt: Wenn ich mich im Glauben an meine Existenz irre, dann irre ich mich nicht im Glauben an meine Existenz. Daher irre ich mich nicht in meinem Glauben an meine Existenz. Damit gibt es zumindest eine wahre Aussage.
Augustinus hält außerdem an dem Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch als Voraussetzung alles Denkens und als wahre Aussage fest. Augustinus vertrat die Lehre von der Prädestination, wonach der Mensch zur Seligkeit oder zur Verdammnis von Gott vorausbestimmt ist.
Der Mensch ist von Natur aus ein Gemeinschaftswesen. Die Gemeinschaft ist notwendig, damit der Mensch seine Anlagen entwickeln kann. Der Staat ist zwar nicht natürlich, aber nötig, um die schlimmsten Folgen des Sündenfalls zu beheben. Der Staat hat sich um Gesetz, Ordnung und den materiellen Wohlstand zu bemühen. Die geistige Wohlfahrt wird dem Einzelnen überlassen. Hier setzt auch das Zitat »Ama et fac quod vis« an.
Augustinus übte u. a. durch Petrus Lombardus Sententiae großen Einfluß auf die mittelalterliche Philosophie aus. Seine von der Stoa inspirierte Zeichentheorie beeinflußte u. a. Roger Bacon.
Das Bivalenzprinzip
Prinzip der Zweiwertigkeit bzw. Bivalenzprinzip (lat. bi-valeo, sich auf zwei beziehen) nennt sich das semantische Prinzip, wonach jeder Satz entweder wahr oder falsch sein muß, unabhängig von unserer Fähigkeit, seinen Wahrheitswert festzustellen.
Das schon bei Aristoteles diskutierte Prinzip wird in der klassischen Aussagenlogik durch Bewertungen umgesetzt, die Abbildungen der Aussagenvariablen in die zweielementige Boolesche Algebra.
Aus dem Prinzip der Zweiwertigkeit folgen zwei Prinzipien:
1. Das Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch, (auch: Satz vom Widerspruch, Prinzip vom Widerspruch, Kontradiktionsprinzip) das besagt: Keine Aussage ist zugleich wahr und falsch.
2. Das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten, welches auch tertium non datur (lat.: ein Drittes gib es nicht) genannt wird: Jede Aussage ist wahr oder falsch.
Als erster formulierte Aristoteles die logischen Grundgesetze des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten und wendete sie auf Aussageverbindungen an. Das Prinzip der Zweiwertigkeit wird für nicht-klassische Logik zurückgewiesen oder verändert, indem auf das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten verzichtet und angenommen wird, dass Aussagen mehr als zwei Aussagen Wahrheitswerte (mehrwertige Logik) oder keine Wahrheitswerte haben können. Auch die intuitionistische Logik, verzichtet auf das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten. Parakonsistente Logiken verzichten auf das Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch und akzeptieren, dass Aussagen mehrere Wahrheitswerte haben können. Ähnlich die imaginäre Logik von N. A. Wassiljew. In Dummetts Sprachphilosophie ist die Zustimmung zum Prinzip der Zweiwertigkeit charakteristisch für den bedeutungstheoretischen Realisten.
Background Information
The Initial Situation
The conductor Peter Stangel asked Wolfgang Beinert to design an unusual emblem for him. The design was not to have a commercial or promotional appearance and should culturally reflect his personality. Peter Stangel corresponds worldwide in five languages and across different cultural spheres.
About the Client
Peter Stangel is a conductor, general music director, and passionate interpreter of works by Mozart, Verdi, Wagner, and Kurt Weill, among others. He fundamentally seeks a balance between tradition and modernity. »Without alienating the established audience, I try to attract new listeners, win them over, and open concerts to new circles of listeners,« says Peter Stangel.
Analysis
Beinert delved into Stangel’s personality, his central concerns, and statements: music is his life. Being a conductor is not just a profession for him but a passion. He yearns to conduct and to experience and live music. He loves music. He is both tolerant and very clear. He questions things. He seeks contact. He is conservative while open to modern ideas. He is an individualist and not one for convenient solutions.
Approach to the Solution
After Wolfgang Beinert engaged deeply with Peter Stangel and got to know him better, it became clear to him that a formal design would not do justice to Stangel as a person. The essence of his reflections: only a conceptually graspable credo could serve as the central starting point for a visualization.
The Credo
»Ama et fac quod vis! Sehnsucht : Leidenschaft : Musik« (Love and do what you will! Longing : Passion : Music). The credo (Latin credo… “I believe,” meaning perception or confession) refers not only to Stangel’s life philosophy but also to the world of great music—Mozart, Verdi, Wagner, Weill.
»Music does not express the passion, love, or longing of this or that individual in a particular situation; it expresses passion, love, and longing itself.« Richard Wagner articulated this sentence in 1876 during the opening of the Festspielhaus in Bayreuth, notably marking the first time in music history that a conductor stood before the orchestra with his back to the audience.
This almost »Wagnerian« claim is contrasted by the Augustinian credo »Love and do what you will!« This contrast creates a philosophical tension that invites prolonged and personal interpretation, drawing the observer into engagement, consistent with the principle of bivalence.
Typography and Design
Typography in the outer circle: Typeface Six by Neville Brody, England, 1990, from the FontShop typeface library. A very bold decorative typeface with unusual, almost abstract letterforms (C, Q, and O). This font represents »The New Age« and modernity.
Inner circle: Small caps of Filosofia from the Emigre typeface library. An Antiqua typeface designed by Zuzana Licko, USA, 1996. This typeface is a modification of the classical Bodoni by the Bauersche Gießerei (1926), with a more pronounced contrast in the shapes. The stroke of the numerals evokes the appearance of 19th-century musical notes, the golden age of conductors as primus inter pares. Filosofia includes all necessary styles (regular, italic, caps, bold) and Anglo-Saxon ligatures. The entire stationery set is typographed in Filosofia.
Center: (Semi-)Heraldic Rose. Beinert refrains from using traditional heraldic design, as its language of forms lacks the desired elegance. Instead, he illustrates the rose in an imaginative French style of the 19th century.
Composition: The avant-garde typeface in the outer circle »protects« the conservative, delicate forms at the center of the emblem. The massive Typeface Six provides both a thematic and formal contrast.
Production
The credo or emblem is generally implemented only as a blind embossing—never in print. Even on envelopes and labels, the credo is embossed. The emblem is intended to take effect only on the second or even third glance.
Comprehensibility
The credo merges in a simple text-image language into an emblem that dispenses with color. The claim in the outer circle was deliberately formulated in Latin—the language of the humanists—and typeset in the highly fashionable, international typeface Six. A straightforward reading and comprehension of its statements is intentionally difficult, for the credo reveals itself neither formally nor in content at first sight.
It thus appears mystical, timeless, and resists immediate categorization. It defies the fast-paced zeitgeist. The emblem affords itself an elitist luxury: it requires explanation. It challenges the viewer and invites them to serious engagement—and, if desired, to a sophisticated exchange.
Graphic design here is shown in its purest form—it takes a subordinate role and becomes, in an intelligent and aesthetic way, a means to an end.
The rose at the center of the emblem
The rose, in the formal language of heraldry, is an integral part of the credo. The rose—valued for its fragrance, beauty, and grace despite its thorns—is among the most common symbolic plants since classical antiquity. In the Western world, it plays a role similar in significance to that of the lotus in Asia. In antiquity, the rose was consecrated to Aphrodite (Venus). According to myth, the red rose sprang from the blood of Adonis. It was a symbol of love and affection, of fertility, and also of reverence for the dead. In Christianity, the red rose was, among other things, a sign of Christ’s shed blood and wounds. It also symbolizes the chalice that caught the holy blood. For this reason, it is also a sign of the mystical rebirth of Jesus.
In alchemy, the rose—most often depicted with seven petals—served as a symbol of complex relationships, such as the seven planets with their corresponding metals, or various stages within alchemical operations. For the general public, the rose—today as in the past—remains the symbol of love.
Briefly on Aurelius Augustine (354–430 AD)
The philosopher and theologian Augustine was trained in rhetoric in Carthage and, in 374, became a teacher of this subject. In 383, he was called to Rome and shortly thereafter to the imperial residence of Milan, where he served as a rhetorician. The crises of his youth were recorded between 397 and 401 in his Confessions, one of the first individualistic autobiographies in world literature.
The reading of Cicero’s Hortensius led Augustine to philosophy. For many years he was a follower of Manichaeism, then briefly of skepticism. In Milan, he encountered Neoplatonism, which led him to Christianity. He was baptized in 387. In 391, he was ordained a priest in Hippo Regius, North Africa, and from 396 until his death served as bishop of that city.
For Augustine, theology and philosophy cannot be sharply distinguished. This position is evident in his maxim: »I believe in order to understand« (credo, ut intelligam). Without divine illumination in our faith, we cannot grasp wisdom (sapientia), by which we attain blessedness (beatitudo). The desire for blessedness is, for him, the sole reason to philosophize; philosophy is a means of deepening faith.
Augustine adopts Plato’s distinction between the mutable world of appearances and the eternal, immutable world of ideas. He takes up Plato’s view that only what is real can be fully known, along with Plato’s dualism of soul and body.
Against the skeptics, Augustine argues: if someone errs in their belief, they nevertheless exist, for one who does not exist cannot err. It follows that if I am mistaken in believing in my own existence, I nevertheless exist. If I exist, I cannot be mistaken in believing in my own existence. From these last two premises, it follows: if I am mistaken in believing in my own existence, then I am not mistaken in believing in my own existence. Therefore, I am not mistaken in believing in my own existence. Hence, there is at least one true statement.
Augustine also upheld the law of non-contradiction as a prerequisite of all thinking and as a true statement. He maintained the doctrine of predestination, according to which human beings are foreordained by God either to salvation or to damnation.
Man is by nature a social being. Community is necessary for humans to develop their capacities. The state is not natural, but it is necessary to remedy the worst consequences of the Fall. The state must concern itself with law, order, and material welfare, but spiritual well-being is left to the individual. This is also the context of his statement: »Ama et fac quod vis« (Love, and do what you will).
Augustine exercised great influence on medieval philosophy, for example through Peter Lombard’s Sentences. His semiotic theory, inspired by the Stoics, influenced, among others, Roger Bacon.
The principle of bivalence
The principle of bivalence (bi-valeo, to refer to two) is the semantic principle that every statement must be either true or false, regardless of our ability to determine its truth value.
Discussed already by Aristotle, the principle is implemented in classical propositional logic through valuations that map propositional variables into the two-element Boolean algebra.
From the principle of bivalence follow two further principles:
-
-
-
- The law of non-contradiction (also: principle of contradiction): no statement can be both true and false at the same time.
- The law of the excluded middle (tertium non datur—there is no third option): every statement is either true or false.
-
-
Aristotle was the first to formulate the logical laws of non-contradiction and the excluded middle and to apply them to compound statements.
In non-classical logic, the principle of bivalence is rejected or modified, either by abandoning the law of the excluded middle and allowing that statements may have more than two truth values (many-valued logic) or none at all, or by abandoning the law of non-contradiction and allowing that statements may have multiple truth values (paraconsistent logics), as in N. A. Vasiliev’s imaginary logic. In Michael Dummett’s philosophy of language, adherence to the principle of bivalence is characteristic of a semantic realist.